
Das Centre de Ressources Biologiques de la Vigne (CRB-Vigne), eine Versuchseinheit des französischen Instituts für Agrarforschung (INRA) in Montpellier, wurde vor 140 Jahren gegründet und besitzt heute 8.000 Akzessionen aus allen Weinbauländern. Die Sammlung umfasst eine große Vielfalt an Rebsorten, sowie Unterlagen, Hybriden und mit Vitis vinifera verwandte Arten. Sie ist der Erhaltung, Charakterisierung und Nutzung der genetischen Ressourcen der Rebe gewidmet.
Im Rahmen der Arbeiten der OIV-Sachverständigengruppe GENET (Genetische Ressourcen und Rebenzüchtung) der Kommission „Weinbau“ (siehe Organigramm des Wissenschaftlich-Technischen Ausschusses der OIV) , besuchten Vertreter der OIV das Centre de Ressources Biologiques de la Vigne (CRB-Vigne) in Vassal-Montpellier.
Der Generaldirektor der OIV, Pau Roca, der Vorsitzende der Sachverständigengruppe GENET, Luigi Bavaresco, und der Leiter des OIV-Referats „Weinbau“, Alejandro Fuentes Espinoza, trafen Cécile Marchal, Leiterin von CRB-Vigne sowie die Experten Jean-Michel Boursiquot (Montpellier Sup Agro, UMR AGAP) und Thierry Lacombe (INRA Montpellier, UMR AGAP).

Gemeinsam für die Erhaltung und den Schutz des weltweiten genetischen Erbes der Rebe
Die Ziele von CRB-Vigne sind ebenfalls eine Priorität der OIV, insbesondere im Hinblick auf bestimmte Maßnahmen, die von der Kommission „Weinbau“ durch ihre Sachverständigengruppe GENET eingeleitet wurden.
Während des Besuchs wurde die entscheidende Rolle hervorgehoben, die die OIV für die Erhaltung und den Schutz des genetischen Erbes der Rebe auf internationaler Ebene spielen muss.
Es wurden folgende Punkte angesprochen:
- Unterart Vitis vinifera subsp. Sylvestris oder Labrusca: Diese Unterart, die als Vorfahre von Vitis vinifera betrachtet wird, ist in Frankreich geschützt, da sie als bedroht gilt. Die Gefahr des Aussterbens besteht auch in anderen Ländern. Labrusca spielt als Genreservoir eine Rolle, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt im Weinberg heute entscheidend ist, insbesondere angesichts des Krankheitsdrucks und/oder der Anpassung an künftige Klimaschocks. Die OIV plant daher Maßnahmen zur Förderung der Erhaltung und des Schutzes von Labrusca auf internationaler Ebene.
- Die OIV muss ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Erhaltung der dokumentarischen Ressourcen der ampelographischen Sammlungen auf globaler Ebene spielen. Sie sieht Maßnahmen vor, die es ermöglichen, das Format der dokumentarischen Ressourcen der ampelographischen Sammlungen an die neuen Praktiken anzupassen, die die digitale Revolution mit sich bringt, um allen den Zugang zu diesem Wissen zu erleichtern und den Akteuren des Sektors neue Möglichkeiten zu bieten.
- Die laufenden Arbeiten der Sachverständigengruppe GENET in Bezug auf die OIV-Deskriptoren der Vitis-Arten sind von großer Bedeutung. Die OIV, die bei der Beschreibung der Vitis-Arten eine führende wissenschaftliche und technische Rolle spielt, nimmt derzeit eine Aktualisierung dieser Deskriptoren vor.
Die Sortenbeschreibung, insbesondere die Ampelographie, ist im Weinbau auch heute noch ein wichtiges Instrument, um den verschiedenen Akteuren des Weinbausektors eine bessere Auswahl der produktiven Sorten zu ermöglichen und den neuen Herausforderungen in Bezug auf die Umwelt und den Klimawandel zu begegnen.
Der Generaldirektor der OIV hofft, dass diese Maßnahmen zu den wichtigsten Prioritäten der OIV und der Kommission „Weinbau“ zählen werden, da im Weinbausektor zunehmend diversifizierte Instrumente und Antworten auf verschiedenen Ebenen benötigt werden, um weiterhin zur Entwicklung des Sektors beizutragen.


In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste verlieh die OIV dem Autor des enzyklopädischen Wörterbuchs der Rebsortennamen und ihrer Synonyme 2016 den Großen Preis der OIV. Sie hob dadurch seinen Beitrag zur Verbreitung der Kenntnisse des Weinbausektors und die Rolle der Ampelographie für die Entwicklung der Weinbauwissenschaften hervor.

Das erstaunliche Gedächtnis und die hervorragenden wissenschaftlichen Kenntnisse von Prof. Pierre Galet haben bei zahlreichen Forschern oftmals große Bewunderung hervorgerufen. Letztere sind dankbar für das außergewöhnliche Wissen, das er durch seine international anerkannten Werke weitergegeben hat:
1947 - Istanbul, Türkei: Ehrendiplom für das mit Henri Angel geschriebene Buch „Les porte-Greffes“ (Unterlagen)
1953 - Rom, Italien: Preis der Jury in der Kategorie „Weinbau“ für das Buch „Précis d'ampélographie pratique“ (praktische Ampelographie)
1963 - Paris, Frankreich: Preis der Jury in der Kategorie „Weinbau“ für das Buch „Cépages et Vignobles de France“ (Rebsorten und Weinberge in Frankreich), Bände 1 und 2
1979 - Stuttgart, Deutschland: Weinbaupreis für das Buch „Les Maladies et les Parasites de la vigne“ (Krankheiten und Schädlinge der Rebe), Band 1
1983 - Johannesburg, Südafrika: Preis Hors Concours in der Kategorie „Weinbau“ mit Silbermedaille für sein gesamtes Schaffen
2001 - Adelaide, Australien: Preis der Jury in der Kategorie „Weinbau“ für das Buch „Cépages et Vignobles de France“ (Rebsorten und Weinberge in Frankreich), 2. Ausgabe, Bände 1 und 2, mit Silbermedaille
2006 - Paris, Frankreich: Preis der Jury in der Kategorie „Weinbau“ für das Buch „Cépages et Vignobles de France“ (Rebsorten und Weinberge in Frankreich), 2. Ausgabe, Band 3 (2 Teilbände)
2016 – Paris, Frankreich: Großer Preis der OIV für seinen Beitrag zur Verbreitung der Kenntnisse des Weinbausektors und als Wertschätzung seines international anerkannten Schaffens

Wie Brasilien erklärte, waren die Hauptziele dieser Überarbeitung die Verhinderung betrügerischer Praktiken, der Verbraucherschutz, der Schutz der menschlichen Gesundheit, die Festlegung der Qualitätsanforderungen und die Lebensmittelsicherheit.
Die Meldung der Überarbeitung der Ausfuhrmodalitäten bei der WTO hatte bei den Fachleuten des Sektors ernsthafte Bedenken hervorgerufen. Es bestand weiterhin Unklarheit darüber, ob die Analysewerte für jeden der Parameter aller auf den Markt gebrachten Erzeugnisse schon mit der Analysebescheinigung des Ausführers bereitgestellt werden müssen.
Die Akteure des Sektors waren angesichts des erheblichen Anstiegs der Kosten der Analysen, die für Weinausfuhren nach Brasilien ab dem 15. Dezember 2019 vorzulegen sind, besorgt. Einige Länder waren nicht in der Lage, bestimmte Analysen durchzuführen.
Durch die im Amtsblatt veröffentlichte normative Anweisung 75 vom 31. Dezember 2019, die die Kontrollverfahren und das offizielle Dokument festlegt, das als Grundlage für die Durchführung der neuen Maßnahme („Norma Operacional“ 01 vom 24. Januar 2019) dient, wurden alle Zweifel ausgeräumt. Der Anhang dieser Norm enthält für jede Produktart eine Übersichtstabelle mit den Analyseparametern, den zulässigen Höchst- und Mindestgrenzen und den Anforderungen an die Maßnahmen in den verschiedenen Kontrollphasen.
Das OIV-Sekretariat hat einen Vermerk [EN] verfasst, der den Überprüfungszyklus der Durchführungsbestimmungen für die Ausfuhr von Weinen und Weinbauerzeugnissen nach Brasilien zusammenfasst [hier].

We are looking for a person with a strong academic background in data science in order to sustain our team and the experts in the digital objectives of the Strategic Plan.
Find here the job offer
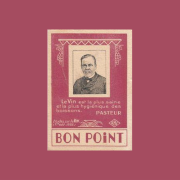
1930 veröffentlichte das O.I.V. , damals das „Internationale Weinamt“, das am 29. November 1924 gegründet wurde, im „BULLETIN INTERNATIONAL DU VIN“ Nr. 24 die Regelung für den ersten Preis der O.I.V.
Es handelt sich um einen Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für die Erstellung von Texten und Legenden in französischer oder in einer der Sprachen der Länder, die der OIV „beigetreten“ sind, sowie für die Illustration dieser „Propagandabroschüre" zugunsten des Weins und seiner gesundheitlichen Vorteile mit dem Titel: „Die Wahrheit über den Wein“ “. Die Wettbewerber müssen die verschiedenen Vorzüge des Weins ab der „frühesten Kindheit“ aufzeigen: „Stärkungsmittel“ oder „Arzneimittel in kleinen, vom Arzt verschriebenen Dosen“. Dann von 10 bis 12 Jahren: Angabe, dass „moderate Dosen Wein Bestandteil der Hauptmahlzeiten sein sollten“. Schließlich werden für das Erwachsenenalter für „gesunde Personen... alle Gründe angeführt, die für die Verwendung dieses Getränks sprechen.“
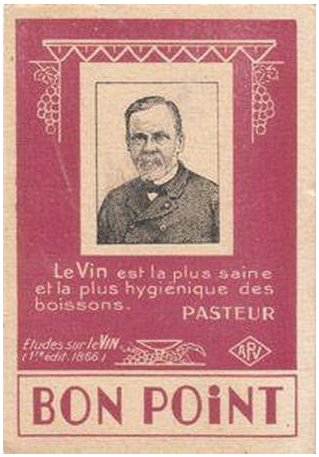
Besuchen Sie die Pandor-Website
Konsultieren Sie die OIV Bulletins
Seitennummerierung
- Erste Seite
- Vorherige Seite
- …
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- …
- Nächste Seite
- Letzte Seite